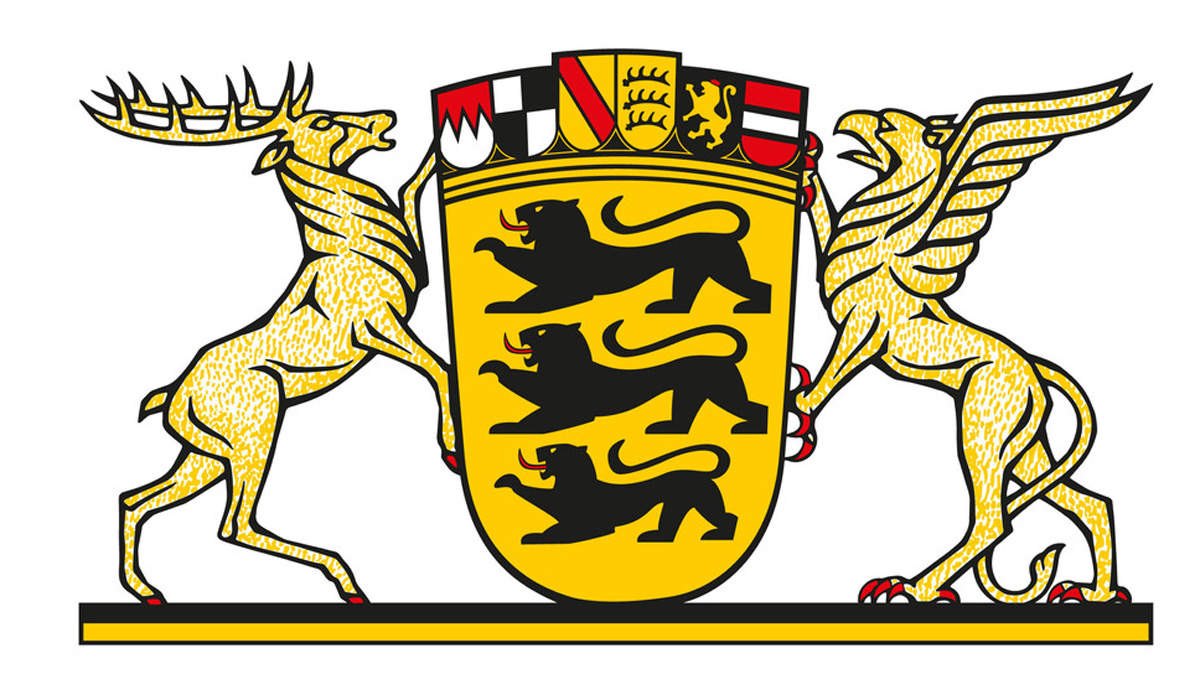
Die Gründung einer Landespflegekammer ist ein langwieriger Prozess. Der Startschuss fiel am 24. Mai 2023: An diesem Tag hatte der baden-württembergische Landtag das Landespflegekammergesetz verabschiedet.
Gründungsausschuss der Pflegekammer bereitet Registrierung vor
Am 18. Juli wurden die Mitglieder des Gründungsausschusses offiziell benannt, dessen Aufgabe es ist, die notwendigen Strukturen für die Pflegekammer Baden-Württemberg zu etablieren. Er bereitet auch die Wahl der Kammerversammlung vor, wofür die künftigen Mitglieder der Pflegekammer zunächst registriert werden müssen.
Ab dem 24. August werden die zuständigen Arbeitgeber angeschrieben und um die Registrierung der bei ihnen angestellten Pflegefachkräfte gebeten. Die Registrierung soll online ab dem 26. September möglich sein. Ab Ende 2023 werden dann die registrierten Pflegekräfte selbst schriftlich kontaktiert, um ihnen die Möglichkeit zu geben, der Registrierung zu widersprechen.
Für die Registrierung sind 18 Monate eingeplant. Wenn in dieser Zeit mindestens 60 Prozent der 110.000 in Baden-Württemberg tätigen Pflegekräfte der Mitgliedschaft zugestimmt haben – diesen Anteil bezeichnet man als Errichtungsquorum – wird die Vollversammlung der Pflegekammer gewählt. Sollte diese Quote nicht erreicht werden, kann die Gründung der Pflegekammer noch scheitern.
Welche Aufgaben soll die Pflegekammer übernehmen?
Die Pflegekammer ist als Selbstverwaltung für beruflich Pflegende gedacht. Sie soll eine professionelle pflegerische Versorgung sicherstellen und Pflegefachkräften die Möglichkeit geben, das Berufsbild weiterzuentwickeln. Zu ihren Aufgaben gehören beispielsweise das Formulieren einer einheitlichen Berufsethik und die Bekämpfung von beruflichen Missständen.
Als Kernaufgabe nennt das Sozialministerium Baden-Württemberg die Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufs. Dies gestaltet sich allerdings dadurch schwierig, dass die tariflichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen für Pflegekräfte zwischen Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und Gesetzgeber ausgehandelt werden.
Die Kammer kann also keinen direkten Einfluss nehmen, soll aber laut Sozialministerium „im konkreten Einzelfall aktiv werden, etwa einen Arbeitgeber durch Besuch eines ‚Ombudsmannes‘ oder einer ‚Ombudsfrau‘ auf bekannt gewordene Missstände hinweisen und eine Beratung zur Überwindung der Probleme anbieten.“
Legitimiert wird sie dabei durch das Heilberufe-Kammergesetz, dass ihr den Auftrag zuschreibt, „die zuständigen öffentlichen Stellen in Fragen der Normsetzung und Verwaltung zu beraten und zu unterstützen sowie Sachverständige zu benennen“. Auch für die Qualitätssicherung soll die Kammer zuständig sein.
Dazu gehören sowohl die Förderung der Ausbildung wie auch die Förderung von Präventionsmaßnahmen. Mittelfristig soll die Pflegekammer auch Fort- und Weiterbildungsaufgaben übernehmen.
Für und Wider: Wird die Pflegekammer gebraucht?
Das Thema Pflegekammer polarisiert. Berufsverbände wie der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) sprechen sich klar für die Kammern aus, da verkammerte Berufe in der Öffentlichkeit und im politischen Raum verstärkt wahrgenommen würden. Das erhöhe die Wertschätzung des Berufs und mache pflegerische Expertise in der Politikberatung und Gesetzgebung verfügbar. Die Verkammerung fördere die berufliche Identität des Pflegeberufs.
Pflegekammern bestehen nur aus Fachkräften und geben so den Menschen in der Pflege die Möglichkeit, mit der Politik ins Gespräch zu kommen und Lobbyarbeit im eigenen Interesse zu betreiben. Auch die Etablierung von Qualitätsstandards, die finanzielle Unabhängigkeit von berufsfremden Entscheidern und die Beratung der Kammermitglieder in rechtlichen Fragen sind Argumente, die für die Einrichtung von Pflegekammern sprechen.
Gegner kritisieren mangelnde Kompetenz
Die Gegner der Pflegekammern sprechen in erster Linie deren mangelnde Kompetenzen an. So kritisiert die Gewerkschaft ver.di, dass eine Pflegekammer wenig zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen tun könne, da sie weder bei den Tarifverhandlungen noch bei der Personalbeschaffung die nötige Entscheidungsgewalt hätte.
Ein weiteres Argument ist, dass das Kammermodell sich an den Bedürfnissen freier Berufe ausrichtet. Pflegende sind aber zum größten Teil angestellt, was auch bedeutet, dass die Pflegekammer im Gegensatz zu anderen Kammern keine Altersvorsorge anbietet – mit der Begründung, dass mehr als 90% der zukünftigen Kammermitglieder in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert seien.
Auch die Verpflichtung zur Mitgliedschaft ist vielen ein Dorn im Auge. Verpflichtet sind dabei alle Pflegefachkräfte mit dreijähriger Fachausbildung, die nicht nur vorübergehend in der Pflege tätig sind und ihren Beruf in Baden-Württemberg ausüben.
Ist die Kammer einmal errichtet, ist ein Widerspruch gegen die Registrierung nur dann berechtigt, wenn einer dieser Gründe nicht oder nicht mehr zutrifft. Problematisch ist das, weil die Kammer sich selbst finanzieren muss. Mit der Mitgliedschaft wird also auch ein Beitrag fällig, der monatlich je nach Gehalt etwa sechs bis neun Euro betragen soll. Das ist vielen Pflegekräften zu hoch.
Wie geht es mit der Pflegekammer weiter?
Grundsätzlich müssen mindestens 60 Prozent der Pflegefachkräfte in Baden-Württemberg der Errichtung der Pflegekammer nicht widersprechen. Der Gründungsausschuss wird die zukünftigen Mitglieder der Kammer per Brief über ihre Registrierung informieren und sie auf die Möglichkeit hinweisen, eine Einwendung gegen die Registrierung einzulegen.
Dafür haben sie sechs Wochen Zeit. Haben zum Stichtag – das ist der 11. März 2024 – mehr als 40 Prozent der Pflichtmitglieder eine Einwendung erhoben, wird keine Pflegekammer errichtet und der Gründungsausschuss aufgelöst.