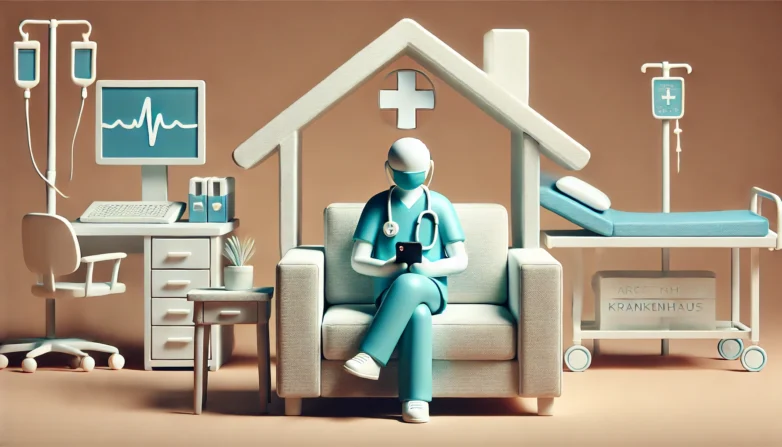
Was ist Rufbereitschaft und wann darf sie angeordnet werden?
Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 3. Oktober 2000 (NZA 2000, S. 1227) Rufbereitschaft als die Verpflichtung des Arbeitnehmers definiert, sich an einem frei gewählten Ort bereitzuhalten, um im Bedarfsfall kurzfristig die Arbeit aufzunehmen. Entscheidend ist, dass der Arbeitnehmer während dieser Zeit nicht aktiv arbeitet und sich frei bewegen kann.
Arbeitgeber dürfen Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß nur in Ausnahmefällen Arbeit anfällt. Die tatsächliche Arbeitsaufnahme muss mithin unvorhersehbar sein (vergleiche hierzu: § 7 Absatz 4 Satz 1 TVöD).
Ist Rufbereitschaft Arbeitszeit oder Ruhezeit?
Ein entscheidender Punkt ist, dass die nicht in Anspruch genommene Zeit während der Rufbereitschaft als Ruhezeit und nicht als Arbeitszeit gewertet wird. Das bedeutet, dass Rufbereitschaft nicht auf die maximale Arbeitszeit von 48 Stunden pro Woche im Durchschnitt von sechs Monaten angerechnet wird. Nur wenn der Arbeitnehmer während der Rufbereitschaft tatsächlich zur Arbeit gerufen wird, zählt diese Zeit als Arbeitszeit.
Wann muss stattdessen Bereitschaftsdienst angeordnet werden?
Demgegenüber unterscheidet sich die Arbeitsform „Bereitschaftsdienst“ erheblich von die der Rufbereitschaft. Bereitschaftsdienst ist immer in den Fällen anzuordnen, wenn eine Arbeitsaufnahme wahrscheinlich und vorhersehbar ist. Wichtig in diesem Zusammenhang ist allerdings, dass die tatsächliche Arbeitszeit den Bereitschaftsdienst nicht dominieren darf.
Laut § 7 Absatz 3 TVöD muss sich der Arbeitnehmer während des Bereitschaftsdienstes an einer vom Arbeitgeber festgelegten Stelle aufhalten. Dies bedeutet, dass der Arbeitnehmer den Aufenthaltsort nicht frei wählen kann. Dieser Umstand führt dazu, dass die gesamte Zeit des Bereitschaftsdienstes, auch die Zeit in welchem der Arbeitnehmer gegebenenfalls schläft, arbeitszeitrechtlich als Arbeitszeit zu werten ist.
Arbeitgeber müssen die 48-Stunden-Regel beim Bereitschaftsdiensteinsatz zwingend beachten!
Da der Bereitschaftsdienst vollumfänglich als Arbeitszeit zählt, müssen die Arbeitgeber darauf achten, dass die wöchentliche Höchstarbeitszeit nicht überschritten wird. Nach dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG) darf die wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt von sechs Monaten bzw. 24 Wochen 48 Stunden nicht überschreiten.
Wer Bereitschaftsdienste in den Dienstplänen einplant, muss daher sicherstellen, dass diese Grenze nicht verletzt wird, um Bußgelder oder schlimmstenfalls strafrechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
Fazit
Während Rufbereitschaft grundsätzlich zur Ruhezeit zählt, gehört Bereitschaftsdienst arbeitszeitrechtlich voll zur Arbeitszeit. Arbeitgeber müssen genau prüfen, welche Form des Bereitschaftssystems sie einsetzen dürfen, um sowohl rechtlichen Anforderungen als auch den Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht zu werden.